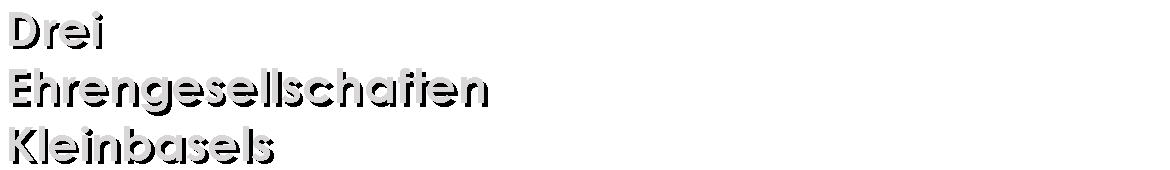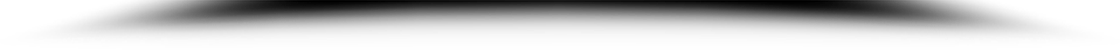Im Silberschatz der E. Gesellschaft zum Rebhaus findet sich eine Reihe von herausragenden silbergefassten Glaspokalen. Die Angaben über den Silber-Besitz können den Rechnungsbüchern, die 1650, und aus den Protokollen, die 1728 beginnen, entnommen werden. In diesen Archivalien finden sich im Zeitraum von 1693 bis 1782 sieben Inventare. Es fehlen aber mit wenigen Ausnahmen nähere Details, um den Zeitpunkt der Entstehung und Übergabe feststellen zu können.
Im Jahre 1684 entstand ein kleiner, 26cm hoher Glaspokal, der von einem silbernen Löwen getragen wird, welcher in der linken Pranke ein Rebmesser und in der Rechten einen Schild mit dem Wappen der Familie Burckhardt hält. Auf dem Schild befindet sich folgende Inschrift: „Johann Bernhard Burckhardt, Hauptmann 1684“. Diese Arbeit wurde von Johann Ulrich Fechter I. (1669 bis 1747) ausgeführt, der anno 1702 auch die silbergetriebene Wappenbuchdecke der Safranzunft anfertigte.
Ein zweiter Glaspokal wurde 1728 ebenfalls von Johann Ulrich Fechter I. geschaffen. Er hat eine Höhe von 30cm. Der Glaspokal wird von einem teilweise vergoldeten Löwen getragen, welcher einen Schild mit dem Wappen der Familie Bulacher hält. Auf dem Schild befindet sich die Inschrift: „Nicolaus Bulacher elter ward Oberster Meister anno 1728“. Bulacher schenkte diesen Pokal also zu seiner Ernennung als Obristmeister. Er starb 1758. Dieser Pokal steht seit 1886 als Depositum im Historischen Museum Basel.
Ein dritter, 29cm hoher Glaspokal wird von einem silbernen Löwen getragen, der mit der linken Pranke einen Schild mit dem Wappen der Familie Obermeyer und der Inschrift „Frantz Obermeyer ward Schreiber 1717, Mitmeister 1723, des Rats 1750, war Obermeister anno 1746 uns verehrt zu solchem Andenken dieses Wenige E.E. Gesellschaft auff dem Rebhausz“ hält. Frantz Obermeyer wurde 1750 Meister zu Spinnwettern. Der Pokal wurde von Joh. Ulrich Fechter d. Jüngeren (1674 bis 1747) verfertigt und ist ebenfalls seit 1886 im Historischen Museum deponiert.
Leider sind heute nur noch wenige Stücke des Silberschatzes erhalten, da in früherer Zeit alten Stücken nicht soviel Wert wie heute beigemessen wurde. Diese wurden mit weniger Bedenken eigenschmolzen als heute und gingen auf diese Art und Weise verloren. Gemäss Protokoll sind beispielsweise im Jahre 1694 einige vergoldete Silberwaren verkauft worden. Der Erlös wurde für eine steinerne Treppe verwendet, welche im Gesellschaftshaus der E. Gesellschaft zum Rebhaus eingebaut wurde. Im Gegenzug wurden jedoch auch neue Prunkstücke geschaffen, welche heute unser Auge erfreuen.
Der damalige Seckelmeister notierte manchmal mit ein paar Worten, wenn zur Anfertigung eines neu gestifteten Gegenstandes gewisse so genannte altmodische Stücke aus dem bestehenden Silberbestand entnommen und mit dem Goldschmied verrechnet wurden, wodurch die Gesellschaft einen nicht unwesentlichen Anteil an den Kosten übernahm. Nur was dann noch ungedeckt war - die Ergänzung des fehlenden Edelmetalls sowie die Herstellungskosten - zahlten die Donatoren aus ihrer eigenen Tasche.
Erwin Hensch, E. Gesellschaft zum Greifen